Am Anfang der amerikanischen Komödie „Ghostbusters“[Fn1] gibt es eine Szene, die in der New York Public Library (NYPL)[Fn2] spielt. Dorthin nämlich werden die Geisterjäger gerufen, weil es im Keller der Bibliothek spukt: Da kramt eine ältere Dame von durchaus freundlichem Ansehen in den Schränken mit den Katalogzetteln und will partout nicht gestört werden; stört man sie aber, verwandelt sie sich in ein schauerliches Monster, das die armen Geisterjäger in die Flucht schlägt und einen klebrigen grünen Schleim auf Katalogzetteln und Geisterjägern zurückläßt.
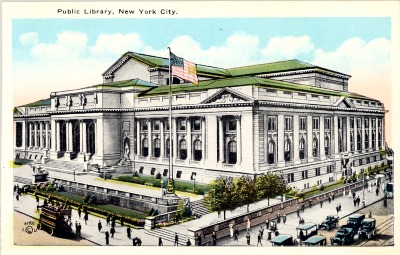
Lang vor den Ghostbusters: Die New York
Public Library auf einer Ansichtskarte , schätzungsweise
aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Für eine größere Ansicht (ca. 350 kB) bitte
dem Link folgen.
Was das mit Bibliothekskultur zu tun hat?
Allerhand. Da dreht ein amerikanischer Regisseur einen Film, der gleich zu Anfang die Stufen eines klassizistischen Gebäudes mit löwenbewährtem griechischen Säuleneingang nimmt, um sofort die beeindruckende Aura des Gebäudes und seines Interieurs aufzusaugen — nur um diese Aura dann im Allerheiligsten, dort, wo die Bibliothekare über den Karteikarten träumen, zu zerbrechen und mittels einer älteren Monsterdame ein heilloses Katalogdurcheinander anzurichten. So etwas funktioniert nur, wenn die Aura wirklich vorhanden ist und dann auch zerbrochen werden kann, um in diesem Zerbrechen entweder Platz für eine Tragödie oder Platz für eine Komödie zu schaffen. Daß Ghostbusters sich für die Komödie entscheidet, heißt also gerade nicht, die Aura der New York Public Library geringzuschätzen, sondern ganz im Gegenteil die Aura dieser ehrwürdigen Bibliothek so bierernst zu nehmen, wie es nur irgend geht, um alsdann am neuralgischen Punkt dieser auratischen Einrichtung, dem Katalog, mit dem Schabernack zu beginnen.
Nun wird man die Aura der NYPL kaum aus dem klassizistischen Gebäude mit griechischen Säulen oder aus ihrer Lage an der Fifth Avenue oder aus den inzwischen mit Computern vollgestopften tempelartigen Lesesälen alleine ableiten wollen. Vielmehr kommt hier zum Tragen, was das Kennzeichen des amerikanischen Bibliothekswesens überhaupt ist: daß die amerikanischen Bibliotheken im 19. Jahrhundert als Einrichtungen entstanden sind, die, vom Bürgertum getragen und finanziert, ebendiesem Bürgertum und darüber hinaus allen Interessierten einen Ort boten und bis heute bieten, an dem man seinen eigenen geistigen Interessen nachgehen kann oder durch fleißiges Studium sein berufliches Fortkommen zu befördern sucht.
Man muß daher den klassizistisch-griechischen Ernst des Gebäudes der NYPL wirklich ernst nehmen: Es geht um nichts Geringeres als um die politische Selbstbestimmung der Bürger einer Polis, die sich nicht in einem vierjährigen Wahlrhythmus erschöpft, sondern sich all der Sachen annimmt, die eine politische Gemeinschaft zur Gemeinschaft machen; und dazu gehört nicht nur, daß man sich seiner eigenen ökonomischen Basis versichert, sondern auch, daß man sich seiner eigenen geistigen Herkunft bewußt bleibt und durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente die Verankerung der Gegenwart in der Vergangenheit immer wieder absichert.
Sucht man nun eine Antwort auf die Frage, wodurch eine Bibliothek zum Instrument der Vergangenheitsverankerung wird, muß man den Blick nur darauf richten, daß die Bibliothek als ein massives Gebäude im Weichbild der Stadt ihren festen Ort hat und daß an diesem konkreten Ort vieles von dem zu finden ist, was die umgebende Stadt und politische Gemeinschaft den nachfolgenden Generationen hinterlassen wollte. Das aber sind keine flüchtigen Informationen, sondern sehr materielle Dokumente, die Platz benötigen.
Wenn die Bibliotheken daher in ihren Regalen solche materiellen Zeichenträger anhäufen, dann häufen sie im wahrsten Sinne des Wortes Vergangenheit an und werden in dieser unablässigen Akkumulation allmählich zu Monumenten der Vergangenheit. Und genau das, ein Monument der Vergangenheit zu sein, macht die Aura der Bibliotheken aus: Es ist eine Aura, die aus der Differenz zwischen unserem geschäftigen Alltag und der akkumulierten Vergangenheit entspringt. Eine Aura, die all unsere oberflächlichen Selbstverständlichkeiten, die wir nicht reflektieren, weil sie einfach und irgendwie funktionieren, negiert und uns auf eine Vergangenheit hinweist, die sich so gar nicht von selbst versteht und zuallererst in einem mühsamen Prozeß geistig angeeignet werden muß, uns aber immerzu als eine fremde Masse gegenübersteht, die allein schon durch ihre massive Fremdheit unseren funktionierenden Alltag in Frage stellt.
Bibliotheken also als Monumente der Vergangenheit, als, im Wortsinne, "Denk-Mäler" und "Denk-Zeichen" für etwas, das anders ist als wir, uns aber aufgegeben ist, weil wir wissen, daß wir in unserer kurzen Gegenwart von diesen lange schon bestehenden Monumenten herkommen und nur zu uns finden, wenn wir uns an diesen Monumenten abarbeiten. Wenn wir irgendetwas Sinnvolles bei dem Wort "Kultur" denken wollen, dann kann es nur dies sein: daß wir zu dem werden, was wir sind, wenn wir uns unserer Vergangenheit annehmen und sie auch wirklich als unsere Vergangenheit pflegen und in Ehren halten. Wir müssen dazu die Vergangenheit weder in ihrem Umfang vollständig überblicken noch müssen wir sie im Detail verstanden haben. Wir müssen lediglich wissen, daß und wo sie zu finden ist – und für denjenigen Teil unserer Vergangenheit, der sich auf Zeichenträgern findet, ist dieses Daß und Wo durch die Bibliothek markiert. Die Sponsoren, Gründer und Erbauer der NYPL hatten das verstanden, als sie die Bibliothek mitten in Manhattan lokalisierten und mit viel Geld für Bestände sorgten, die heute mit 42 Millionen Dokumenten und Sammlungsstücken aller Art, darunter 15 Millionen Bücher, genau jene beeindruckende Masse Vergangenheit bilden, von der hier die Rede ist.
Freilich ist die Vergangenheit auch eine Last. Sie drängt sich in unseren Alltag mit der steten Ermahnung, ebendiesen Alltag in seiner flinken Oberfläche nicht allzu ernst zu nehmen; sie stellt unser einfaches Hier-Sein in Frage und weist auf ein Dort-Sein hin, das viel reichhaltiger ist als alles Hier und Jetzt und das man, will man es haben, nur mit viel Mühe haben kann. Sie beschämt uns mit der Erkenntnis, daß noch die neueste Mode, sei sie nun ökonomisch, künstlerisch oder politisch, wenig mehr ist als die Wiederkehr eines alten Hutes, was wir nur deshalb nicht bemerken, weil wir zu sehr im Alltag leben und unsere Bildung immer und überall an historischer Amnesie leidet. So etwas läßt man sich ungern sagen, und seit der im Altertum praktizierten damnatio memoriae ist daher die Auslöschung der Vergangenheit ein probates Mittel, die Last des Unangenehmen, das diese Vergangenheit darstellt, loszuwerden. Am schönsten wäre es natürlich, man könnte die Vergangenheit in einer Weise loswerden, die es erlaubte, sie bei Bedarf wieder herzuzaubern. Wir bräuchten dann kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn wir die Vergangenheit „wegräumen“, und wir müßten uns andererseits nicht Tag für Tag unsere zeitgenössische Flachheit eingestehen. Tatsächlich gibt es seit einigen Jahrzehnten ein Zauberwort, das genau mit diesem Trick lockt; das Zauberwort lautet „Computer“, und seine neueste Gestalt kommt als Internet daher.
Im Bibliothekswesen hat man den Computer gegen Ende der 1960er und am Beginn der 1970er Jahre entdeckt. Das war die hohe Zeit des Reformierens, als man überall daranging, sich von überflüssigen Vorurteilen zu trennen, um desto ungestörter sich den Entwürfen einer viel besseren Zukunft hingeben zu können. So fand man im Biedermann den Altnazi, unter den Talaren der Professoren den Muff von tausend Jahren, in tradierten Moralkodizes triebfeindliche Zumutungen und im Bibliothekswesen einen Altbestand, der niemals ausgeliehen wurde und allmählich einstaubte. Da kam der Computer gerade recht, der staubfreien Umgang mit etwas erlaubte, was man vorher noch gar nicht gekannt hatte: mit Informationen nämlich, die handlicher als Bücher und ökonomisch rentabler sein und in jedem Fall ganz mühelos auf Abruf bereitstehen sollten. Die Bibliotheken wurden daher am Ende der 1960er Jahre zu „Informationssystemen“[Fn3], die der modernen Industriegesellschaft zu Diensten sein sollten, um mittels bereitgestellter Informationen die auf allen gesellschaftlichen Ebenen angesagten Reformen zu betreiben.
Man muß hier nur das Schlagwort von der „Industriegesellschaft“ durch das der „Informationsgesellschaft“ ersetzen, um sich in der gegenwärtigen Debatte wiederzufinden. Denn sobald, bei fortschreitender Entwicklung der Produktionsmittel, die reale ökonomische Basis der Gesellschaften aus dem Blick gerät und man wirklich zu meinen beginnt, Gesellschaften erhielten sich durch Bearbeitung, Transmission und Speicherung von Informationen, macht es Sinn, in der „Information“ die realökonomische Basis von Gesellschaften zu sehen und folglich jene Einrichtungen, die sich mit der Zurichtung von Informationen beschäftigen, für grundlegend zu halten.
Natürlich unterliegt der so konzipierte Begriff der Information dem naturalistischen Mißverständnis, daß Informationen irgendwie von gleicher Realität wie die Bodenschätze der guten alten Industriegesellschaft oder die physikalischen Entitäten Masse und Energie seien.[Fn4]
Davon kann selbstverständlich keine Rede sein, denn Informationen sind, was ihre physische Realität anbelangt, Daten, die sich auf Datenträgern befinden; und jenseits dieser physischen Realität sind Informationen Zeichen, die nur deshalb Zeichen sind, weil es Menschen gibt, die sie als Zeichen entziffern können. Daß man dieses Mißverständnis nicht recht wahrhaben will[Fn5], liegt nicht einfach in einem intellektuellen Unvermögen, sondern daran, daß das naturalistische Mißverständnis die Bibliotheken als Informationseinrichtungen ungeheuer aufwertet:
Sie dürfen sich nun als realgesellschaftliche Grundlageninstitutionen fühlen, ohne die nichts mehr geht; und das, was da gehen soll, ist die Ermöglichung einer besseren Zukunft überhaupt, deren Realisierung von den richtigen Informationen und also von den informationsbewegten und -bewegenden Bibliotheken abhängt.
Kurz: Bibliotheken sind nun nicht einfach nur unverzichtbare Kultureinrichtungen, sondern betreiben massiv gesellschaftliche Zukunftsermöglichung durch Bereitstellung dringend benötigter Informationen.
Das macht verständlich, warum Bibliotheken sich seit den 1970er Jahren als Avantgarde der Informationsgesellschaft zu verstehen begonnen haben und so begeistert zunächst ihre Kataloge, dann ihre Geschäftsgänge und inzwischen auch ihre Bestände den informationstechnischen Erfordernissen unterwerfen und also digitalisieren, was das Zeug hält. Jeder dieser Digitalisierungsschritte ist ein Schritt in eine Zukunft, in der alles besser werden soll, und so darf sich die Digitalisierung der Bibliotheken als Antizipation dessen verstehen, was durch digitale Informationen gesamtgesellschaftlich erst noch erreicht werden soll: eben eine bessere Zukunft.
Der Mechanismus funktioniert selbst dann noch, wenn die alte Hoffnung auf eine utopische Umgestaltung der Gesellschaft an Ölpreisschocks oder geplatzten Börsenblasen zuschanden wird und man sich statt dessen mit der Sicherung des Wohlstandes oder des „Standorts Deutschland“ begnügen muß. Denn was seither angstbesetzt an politischer „Durchwurstelei“ betrieben wird, versteht sich immer noch als Ermöglichung von Zukunft, wenn es auch längst nicht mehr ums große Ganze und Utopisch-Allgemeine geht. Und also braucht es immer noch Informationen und Bibliotheken als Netzwerke[Fn6] , die ebendiese zukunftsgestaltende Durchwurstelei mit all jenen Daten versorgen, denen man Veränderungsrelevanz zuschreibt, um angesichts der Datenfülle nicht mehr recht zu wissen, was zu tun sei.
Bei all dem bleibt die Vergangenheit freilich auf der Strecke und mit ihr die Kultur, sofern sie bibliotheksrelevant ist. Die allfällige Digitalisierung nämlich sonnt sich jeden Zeitungstag aufs Neue darin, nun diese oder jene Bibliothek im Ganzen oder dieses oder jenes seltene Manuskript im Besonderen digitalisiert und damit für die Zukunft gesichert und weltweit zugänglich gemacht zu haben. Die Digitalisierung nämlich unterwirft alles, was sie digitalisiert, einer instantanen Verfügbarkeit, welche indessen nur unter dem proklamierten Aspekt der Zukunftssicherung ihre unbefragte Bedeutung erhält.
Denn was soll es heißen, daß man nun ein ziemlich abseitiges, aber irgendwie schönes und in irgendeinem unbekannten Kontext auch sicherlich hochbedeutsames Blatt einer mittelalterlichen arabischen Handschrift eines nordafrikanischen Grammatikers mit DFG- oder anderen Mitteln endlich ins Internet eingestellt hat?
Es heißt, genau besehen, nichts. Denn um etwas zu heißen, müßte der Kontext ausgedeutet werden, in dem besagte Handschrift steht, d.h. es müßte so etwas wie Bildung vermittelt werden, in deren Licht die Handschrift dann die ihr zukommende Bedeutung entfalten kann. Eben daran aber ist die Digitalisierung als solche nicht interessiert.
Sie begnügt sich damit, die alte Handschrift prinzipiell und überhaupt weltweit verfügbar zu machen und entkleidet sie damit ihres Kontextes, der doch allererst die Spur legt, in deren Verfolgung man so etwas wie eine Ahnung vom kulturellen Wert der Handschrift gewinnen könnte. Ohne diese Spur aber bleibt die Handschrift weniger ein Unikat als ein Unikum, das im höchsten Fall einen ästhetischen Reiz vermittelt, nicht anders als die afrikanischen Masken, die sich wohlmeinende Bürger in ihr Wohnzimmer stellen, ohne eine Ahnung davon, daß sie damit einem Voodoo-Zauber die Tür geöffnet haben.

Massive Insel im Meer aus Beton: Die New
York Public Library.
Für eine größere Ansicht (ca. 320 kB) bitte
dem Link folgen.
Auf diese Weise entsteht im Internet in der Tat ein gigantischer Pool von Daten aller Art, der im selben Maß, wie er alles speichert und zugänglich macht, ebendieses Alles kulturell zum Nichts schrumpft. Man bemerkt das nur nicht, weil man sich der Zauberkraft des neuen Mediums so gerne hingibt, die darin liegt, daß sie im Bedarfsfall alles wiederzufinden verspricht, was das kulturelle Herz begehrt. Lassen wir einmal beiseite, daß schon dieses Versprechen angesichts der realen Retrievalprobleme in großen Datenbanken ein leeres Versprechen ist – selbst wenn es so wäre, daß man alles finden könnte, was auch immer man wollte: Man könnte mit 99 Prozent davon nichts anfangen, weil es den eigenen kulturellen Horizont übersteigt. Bleibt man aber innerhalb des bekannten und verstandenen kulturellen Horizonts, bringt all die schöne Datentechnik nicht mehr an den Tag, als man schon kannte, nur daß es nun auf technisch neue Art an den Tag kommt.
Und wozu das alles? Das ist die Frage. Sie ist nun nicht mehr dadurch zu beantworten, daß man auf die massiven Vorteile der bibliothekarischen Informationstechnik verweist oder sich geradezu kindlich darüber freut, daß der Datenpool des Internets stetig wächst. Die Antwort liegt nicht auf der Ebene einer solchen Empirie, sondern auf der Ebene der Hoffnungen und Versprechungen, die über die digitale Technik vermittelt werden.
Diese Hoffnungen lauten ganz allgemein – man kann das nicht oft genug wiederholen –, daß die digitale Technik die gesellschaftliche Veränderungstechnik schlechthin sein werde; und diese Hoffnungen zeigen sich im kleinen Soziotop des Bibliothekswesens in dem Gedanken, dank des Einsatzes von Digitaltechnik zur gesellschaftlichen Avantgarde zu mutieren und den Ruch des Verstaubten endlich loszuwerden. So gesehen handelt es sich bei der Digitaltechnik um eine Gestalt gewordene Hoffnungsmaschine, die an die Stelle, an der man bisher nur glauben durfte, miniaturisierte Schaltkreise und lenkbare Datenströme setzt und damit suggeriert, man könne die Hoffnung Realität werden lassen und also Zukunft wirklich selbst gestalten.
Es wundert daher nicht, daß die Durchsetzung des Computers im Bibliothekswesen früh schon die Sorge um das „Ende der Bibliotheken“ aufkommen ließ.[Fn7] Damit war freilich nicht gemeint, daß der Computer das Ende der Bibliotheken sein würde, sondern umgekehrt: das Festhalten am tradierten Bibliothekstypus, am Haus aus Stein und Beton und dem vielen Papier wird zum Untergang der Bibliotheken führen.
Seither leben wir bibliothekarisch in einer Endzeit, die mit der Drohung, das Ende der alten Bibliotheken aus Stein und Papier sei gekommen, diese nicht zu erhalten, sondern abzuschaffen versucht, um sie durch neue digitale Bibliotheken zu ersetzen.
Daß wir dabei nur gewinnen und nichts verlieren könnten, ist die handlungsleitende Illusion, die all jene umtreibt, die sich für Pragmatiker halten und doch Utopisten sind. Denn der digitale Umbau der Bibliotheken kürzt aus diesen die Vergangenheit heraus und betreibt mit ihrer Demonumentalisierung zuletzt ihre Abschaffung und damit ihr wirkliches Ende. Bibliothekskultur kann man das nicht nennen.
Fußnoten
[Fn 1]
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Ghostbusters. (zurück)
[Fn
2]
Material zur NYPL findet man bequem übers Internet. Etwa hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_Public_Library; oder hier:
http://www.nypl.org/ (zurück)
[Fn
3]
siehe etwa den Band "Bibliothekswissenschaft. Versuch einer
Begriffsbestimmung in Referaten und Diskussionen bei dem Kölner
Kolloquium (27.--29. Oktober 1969). Hrsg. von Werner Krieg. Köln:
Greven, 1970. (zurück)
[Fn
4]
Zu diesem Mißverständnis
jetzt Janich, Peter: Philosophie in einer wissenschaftlich geprägten
Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006. (zurück)
[Fn
5]
Im Bibliothekswesen ist Rafael Capurro hier die große Ausnahme.
Siehe dessen Beitrag in dem sonst deprimierenden Band "Conceptions
of library and information science." Ed. by Pertti Vakkari
and Blaise Cronin. London [u.a.]: Taylor Graham, 1992. (zurück)
[Fn
6]
"Netzwerk Bibliothek" lautet denn auch, voll im Trend,
das Motto des 95. Deutschen Bibliothekartages im Jahre 2006. (zurück)
[Fn
7]
siehe etwa James Thompson: The end
of libraries. London: Bingley 1982. (zurück)
Uwe Jochum Fachreferent für Allgemeine Literaturwissenschaft, Amerikanistik, Anglistik, Germanistik, Musik, Pädagogik & Philosophie an der Bibliothek der Universität Konstanz.