Über und gegen Friedrich Kittler
Einer dieser Versuche ist die Promotion von Harald Hillgärtner, „Das Medium als Werkzeug“. Vorgeblich geht es in ihr um die Wahrnehmungs- und Verwendungsweisen von Computern durch Nutzerinnen und Nutzer und um die sich aus diesen Verwendungsweisen ergebenden Aufgaben für die Medienwissenschaft. Dafür hätten allerdings auch 50 oder sogar weniger Seiten dieses Buches ausgereicht. Der Rest der rund 270 Seiten ist entweder redundant oder behandelt sehr abgelegene Nebenthemen, deren Diskussion zum eigentlichen Thema nichts beiträgt, obgleich sie zumeist nicht uninteressant sind. Auch aus diesem Grund wird der dem Buch zugrunde liegende Anspruch, eine realitätsgesättigte Fundierung für eine zeitgemäße Medienwissenschaft zu formulieren, nicht eingelöst. Hinzu kommt, dass das Buch selber in einer über weite Strecken reichlich unzugänglichen Sprache gehalten ist.
Selbstverständlich muss man in Rechnung stellen,
dass es sich bei dieser Arbeit um den Abdruck einer Promotion handelt,
die bekanntlich besonderen Bedingungen unterliegt und die zudem
als erste große wissenschaftliche Veröffentlichung den
Eintritt in die Sphäre der anerkannten Wissenschaft ermöglichen
soll. Verständlichkeit und Stringenz sind daher nicht unbedingt
gefragt. Aber dennoch ist die Frage zu stellen, ob es notwendig
war, dieses Buch in dieser Form und Länge als Manuskript in
ein Verlagsprogramm zu übernehmen.
Zum überwiegenden Teil stellt das Buch eine Auseinandersetzung
mit Friedrich Kittler und der „Berliner Schule“ der
Medienwissenschaft dar. Das ist teils verständlich, da Kittler
immer noch als omnipräsente Figur der deutschen Medientheorie
gelten kann, dessen kritisch gemeinte Forschungen zu weiten Teilen
zu Verdikten geworden sind.
Kittler unterstellt, so die These von Hillgärtner, eine fortschreitende Abhängigkeit der Menschen von Maschinen und Firmen, welche diese Maschinen herstellen oder mit Software bestücken. Dies würde auf eine apodiktische Gesellschaftsvision zulaufen, in welcher Menschen nur noch das tun könnten, was die Maschinen ihnen erlauben würden. Dabei ist das große Feindbild Kittlers die Firma Microsoft, der er vorwirft, den Menschen immer weiter von der eigentlichen Maschine fortzudrängen. Sich dagegen zu wehren sei, wenn überhaupt, durch eine Reflexion der Strategien dieser Firma und durch den Versuch, die Maschine Computer möglichst gut zu verstehen. Der immer wieder – auch bei Hillgärtner – zitierte Punkt, den Kittler hervorhebt ist, dass er, im Gegensatz zu den meisten anderen Medienkritikerinnen und Medienkritikern, einst selber Computer zusammengebaut hätte. Das alles verwirft Hillgärtner in weit ausholenden Explikationen, wobei diese Kritik selber nicht vollständig originell ist, sondern auch von anderen schon geleistet wurde.
Für Hillgärtner ignoriert Kittler, um sein einfaches Bild von der Unterdrückung und Disziplinierung des Menschen durch die Maschine Computer aufrecht zu erhalten, nahezu vollständig die empirische Realität der tatsächlichen Nutzungsweisen von Computern und predigt dabei eine „Eigentlichkeit“, die einer kritischen Befragung nicht standhält. Dabei ist auch für Hillgärtner die Firma Microsoft ein Gegner, allerdings bevorzugt er gegen sie Freie Software und betont die Kreativität von Nutzerinnen und Nutzern im Umgang mit Software und Medien.
Gleichzeitig sind gerade das die stärksten Stellen
seines Werkes, wenn er die vereinfachte Rede von Computer als eindeutig
zu bestimmender Maschine als Ignoranz der „kritischen Medientheorie“
gegenüber den Nutzenden entlarvt. Diese Vereinfachungen, beispielsweise
die beständig wiederholte Aussage, dass alles im Rechner auf
einer binären Codierung basieren würde oder auch die Behauptung,
dass die Nutzenden aus Dummheit von einem Betriebssystem versklavt
seien, würden nach Hillgärtners Analyse vor allem dazu
beitragen, dass sich die Medienkritik weiterhin als kritische Praxis
verstehen könnte, die im aufklärerischen Gestus Missstände
einfach entlarvt. Dies aber nur, indem sie ignoriert, dass Menschen
sehr wohl kompetent mit Rechnern umgehen können.
Hillgärtner will stattdessen den Computer als unterschiedlich
verwendetes Werkzeug verstanden wissen.
Eines seiner Hauptargumente lautet, dass die Menschen Rechner auf sehr verschiedenen Ebenen nutzen. Einige begreifen Rechner als Mittel, um Medien zu manipulieren, andere um durch das Mitschreiben am Linuxkernel direkt auf die Hardware zuzugreifen, wieder andere nutzen einen Rechner als ein Gerät, mit dem sie Zugang zur elektronischen Kommunikation erhalten können. Der Rechner beherrscht die Menschen also gerade nicht, sondern wird von ihnen als Werkzeug verwendet, um sehr unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Insbesondere bei der Nutzung und Veränderung von Medien würden sich Menschen heute weit kreativer zeigen, als dies nach dem Kittlerschen Diktum des Nutzers als „Untertan der Microsoft Corporation“ zu erwarten wäre.
Und gerade diese unterschiedlichen Verwendungsweisen müsste die Medienwissenschaft laut Hillgärtner untersuchen, nicht die vermeintliche Undurchdringlichkeit eines Rechners oder eines Betriebssystems. Es ist leicht ersichtlich, dass dieser Ansatz produktiv sein kann, wenn er denn verfolgt würde. Aber bei Hillgärtner steht er am Ende als Möglichkeit einer weiterführenden Forschung, nicht als angewandter Forschungsansatz.
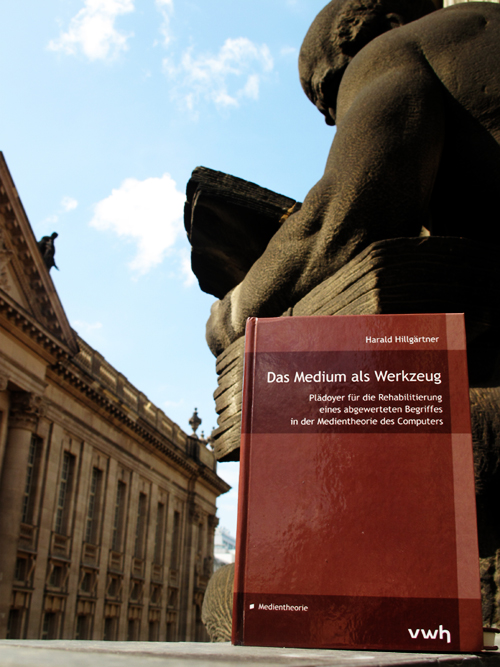
Abb. 1: Das Werkzeug "Medium"
in einer seiner natürlichen Umgebungen:
Gegenüber der Berliner Staatsbibliothek in der Berliner
Dorotheenstraße.
Weiterhin ist das gesamte Buch durchzogen von einem
offenen Bekenntnis zu Freier Software. Hillgärtner hat seine
Promotion auf einem quelloffenen Betriebssystem mit Freier Software
geschrieben. Und er kennt sich mit weiterer Freier Software aus.
Dagegen ist nichts zu sagen, es gibt gute Gründe dafür,
solche Software zu verwenden. Nur führt dieses Bekenntnis bei
Hillgärtner zu keinem Erkenntnisgewinn. Was bringt es, nicht
nur bei den Danksagungen, sondern auch im ebenso im weiteren Text
von Linux, OpenOffice und Sauerbraten (einer freien Gameengine)
zu sprechen, wenn diese Beispiele nur in den seltensten Fällen
auch nur als Beispiel herangezogen werden?
Vielmehr widerspricht sich Hillgärtner hier: einerseits möchte
er darauf hinweisen, dass Nutzerinnen und Nutzer Computer jeweils
individuell nutzen und einrichten und auch mit proprietärer
Software nicht unbedingt an die Maschine gebunden sind, gleichzeitig
will er eigentlich, dass alle Menschen Freie Software nutzen. Aber
so funktioniert die Nutzung von Computern, wie er selber zeigt,
nun mal nicht: nicht die technisch und moralisch bessere Software
setzt sich durch, vielmehr existieren sehr unterschiedliche Softwarelösungen
nebeneinander und werden von den meisten Menschen einfach als Werkzeug
genutzt, weil sie da sind. [Fn
1]
Zum Ende seiner Arbeit hält Hillgärtner noch einmal fest, dass kein Medium totalitär in nur eine Richtung wirkt und dass insbesondere der Computer beziehungsweise die Software als Werkzeug zuerst den Umgang mit Medien verändert und nicht gleich die gesamte Lebensrealität. Das kann man so darstellen, die Frage ist allerdings, ob es dafür einer langatmigen Destruktion des Werkes von Friedrich Kittler bedurft hätte.
Raum? Okay
Einen weiteren Versuch, die Medienwissenschaft zu
updaten, unternimmt Thomas Schindl in seinem Buch „Räume
des Medialen“, das auf seiner Magisterarbeit basiert. Er fragt,
wie die Medienwissenschaft mit dem Raum – verstanden sowohl
als großer geographischer Raum als auch als virtueller Kommunikationsraum
– umgehen soll. Medien existieren für Schindl nicht losgelöst
von Raum. Indem sie produziert und interpretiert werden, prägen
Medien jeden Raum mit und stellen in ihm nicht einfach nur einen
beliebigen Fremdkörper dar.
Ganz offensichtlich wehrt sich Schindl gegen eine Übermacht
hermeneutischer Interpretationsverfahren. Vielmehr postuliert er,
dass es in der Medienwissenschaft, aber auch in angrenzenden Wissenschaften
wie den Kultur- und den Sozialwissenschaften, eine Hinwendung zur
Analyse des sozialen und des virtuellen Raumes geben würde.
Das Ziel seines Buches sei nun, Ansätze für einen solchen
Zugang darzulegen und zu diskutieren.
Dieses Ziel ist fraglos berechtigt, insbesondere wenn man Schindls
Grundpostulat zustimmt. Allerdings wird das Buch diesem Anspruch
nicht gerecht. Vielmehr ist es eine Darstellung dreier sehr unterschiedlicher
Ansätze, die das Verhältnis von Raum und Kommunikation
thematisieren, welche alle drei nicht einmal explizit medienwissenschaftlich
sind.
Im ersten Kapitel stellt Schindl die Arbeit von Harold A. Innis (1894-1952) vor, der sich als Wirtschaftshistoriker mit der Geschichte des geopolitischen Raumes in Kanada als Mediengeschichte befasst hat. Innis begreift in seinen Arbeiten Kommunikation als materiell, also beispielsweise die Verbreitung von Informationen als Voraussetzung und Anstoß für die Errichtung von Wirtschaftszweigen und Transportwegen. Ein wichtiges Postulat Innis' lautet, dass mit dem Entstehen von neuen Medienformen immer auch eine neue Auffassung des Raumes – also hauptsächlich der Frage, auf welche Weiten und in welcher Tiefe man sich auf ihn bezieht – formuliert wird. Allerdings, so die Kritik von Schindl an Innis, verstehe dieser Medien als Einwegkommunikation und kann deshalb für die Analyse heutiger, dialogisch angelegter Medienformen nicht mehr umstandslos verwendet werden.
Im zweiten Kapitel bezieht sich Schindl ohne einen weiteren Übergang auf die Soziologin Saskia Sassen (*1949). Diese ist einerseits dafür bekannt, die Globalisierung als weltweite soziale, wirtschaftliche und auch kulturelle Entwicklung zu begreifen und deswegen sehr oft Untersuchungsschwerpunkte abseits der westlichen Welt zu setzen. Andererseits ist sie auch für einen eklektizistischen und teilweise populärwissenschaftlichen Stil bekannt, der seine Stärken eher beim Aufdecken möglicher Forschungszusammenhänge und dem Erinnern an verdrängte, aber eigentlich weithin bekannte Fakten entfaltet, als in der eigentlichen Forschung oder bei der Beantwortung wissenschaftlicher Fragen. Diese relative Beliebigkeit schlägt sich auch in der Besprechung Schindls nieder, obgleich er sich darauf konzentriert, eine gewisse Stringenz beizubehalten.
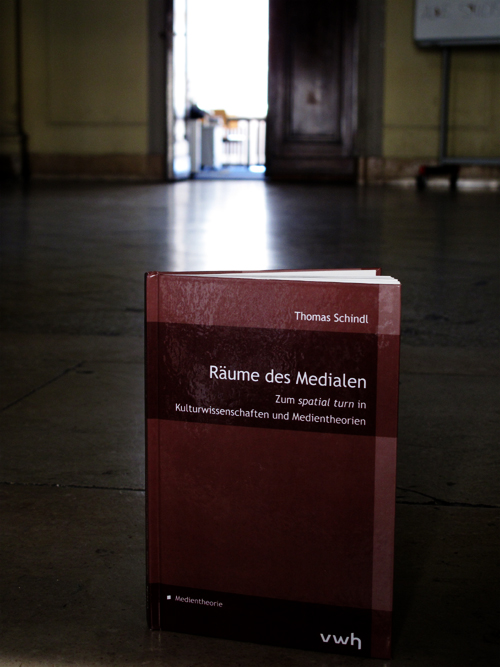
Abb. 1: Das Raum des Medialen
in einer seiner natürlichen Umgebungen:
Im 1.OG des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft.
Grundsätzlich beharrt Sassen darauf, dass der Raum keine natürlich gegebene Entität darstellen würde, sondern vielmehr „durch technische Rahmenbedingungen, kulturelle Praktiken und soziale Interaktionen konstruiert [werde]“. (Schindl, S. 61) Medien, die Kommunikation über weite Strecken hinweg ermöglichten – hier nennt Sassen den Telegraphen als spätest möglichen Anfang dieses Abschnitts der Mediengeschichte –, würden durch diese Kommunikation daran mitwirken, Räume zu konstituieren. Gleichzeitig seien diese Medien in die sozialen Auseinandersetzungen und Machtverhältnisse eingebunden. Durch die Globalisierung und die Verbreitung dialogischer Kommunikationsmittel sei eine weltweite Kommunikationssphäre für diese Auseinandersetzung entstanden, welche gleichzeitig an lokale Bedingungen, Handlungen und Entwicklungen geknüpft sei. Weder gibt es heute den einen rein globalen Kommunikationsraum, noch die vollständig abgeschlossene lokale Kommunikationsebene.
Nach dieser Feststellung schließt das Kapitel und wiederum ohne Übergang wird im dritten Abschnitt des Buches auf den Philosophen Régis Debray (*1940) und dessen Theorie der Mediologie eingegangen. Mit dieser Theorie untersucht Debray Kommunikation als „raumschaffend“ und schließt dabei indirekt an die von Michel Foucault entwickelte Vorstellung des Dispositiv – einer Entität, die einen wirksamen Diskurs, eine „reale Sache“ und deren gegenseitige Verquickung als Zusammenhang denkbar machen soll [Fn 2] – an. Kommunikation ist bei Debray nicht einfach raumkonstituierend, sondern führt als Teil der Menschwerdung auch dazu, den Raum zu domestizieren. Letztlich ist Kommunikation also auch ein Mittel zur Beherrschung des Raumes.
Damit endet das dritte Kapitel, aber auch das Buch. Schindl plädiert am Ende noch einmal dafür, räumliche Strukturen und räumliche Praxis als Medien- und Kommunikationspraxis zusammen zu denken und als ein aufeinander bezogenes Verhältnis zu begreifen. Zudem verweist er noch einmal – wie auch durchgängig im gesamten Text seines Buches – darauf, dass die neuen Medien neue Herausforderungen stellen. Aber es folgt keine Zusammenführung der drei vorgestellten Ansätze, keine Aussicht auf eine mögliche medienwissenschaftliche Praxis, die sich mit dem Raum befasst und auch keine Begründung für die Auswahl gerade dieser sehr unterschiedlichen und zu unterschiedlichen Zeiten formulierten Ansätze. Es scheint fast so, als wäre das Buch auf eine solche Zusammenfassung hin geschrieben worden, aber gerade diese letzten zwanzig Seiten, die einen originären Beitrag hätten leisten können, seien vergessen worden.
Nimmt man diese zwei eher zufällig ausgewählten Werke als einigermaßen repräsentative Beispiele für die aktuellen Debatten in der deutschen Medienwissenschaft – was bestritten werden könnte –, dann wird ersichtlich, dass man sich dort sehr wohl bewusst ist, dass die neuen Kommunikationsmittel und damit einhergehend die neuen Formen der Kommunikation eine Herausforderung darstellen, da sie sich nicht mehr mit schon bekannten medienwissenschaftlichen Methoden untersuchen lassen, zumal gleichzeitig ersichtlich ist, dass sie eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung haben. Aber über dieses Wissen hinaus scheint bislang wenig geklärt zu sein: weder die Begrifflichkeiten, noch die grundlegenden Forschungsmethoden und Forschungsfragen, noch der eigentliche Forschungsgegenstand selber. Dies scheint aber eine Parallele der Medien- zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft darzustellen, wobei es die Medienwissenschaft immerhin schafft, eine einigermaßen breite Diskussion um dieses Problem zu führen.
Fußnoten
[1] Vielleicht ist
es für diesen Absatz wichtig zu erwähnen, dass Hillgärtner
den Autor dieser Rezension in seiner Haltung zu freier Software
auf seiner Seite hat. Auch diese Rezension entstand auf einem Freien
Betriebssystem und in einem Freien Textverarbeitungsprogramm, einfach
weil diese Software sowohl technisch als auch moralisch den proprietären
Lösungen überlegen ist. Die Frage ist allerdings, was
das über den Text der Rezension selber aussagt. Zu vermuten
ist, nichts. (zurück)
[2] Mit dem Konstrukt eines Dispositiv hat sich Foucault explizit von der „unkritischen“ Vorstellung eines zwar geführten, aber nicht wirksamen Diskurses abgegrenzt. Es geht gerade nicht darum, einen Diskurs als reinen Bezug unterschiedlicher Reden zu analysieren, wie dies beispielsweise hermeneutische Verfahren ermöglichen, sondern Diskurse als Anordnung von intelligiblen und nicht-intelligiblen Antworten zu verstehen, die direkten Einfluss auf die Gesellschaft, die Körper und den Raum nehmen.
Karsten Schuldt promovierte in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft zum Thema "Bibliotheken als Bildungseinrichtungen". Er ist unter anderem Dozent an der FH Potsdam.